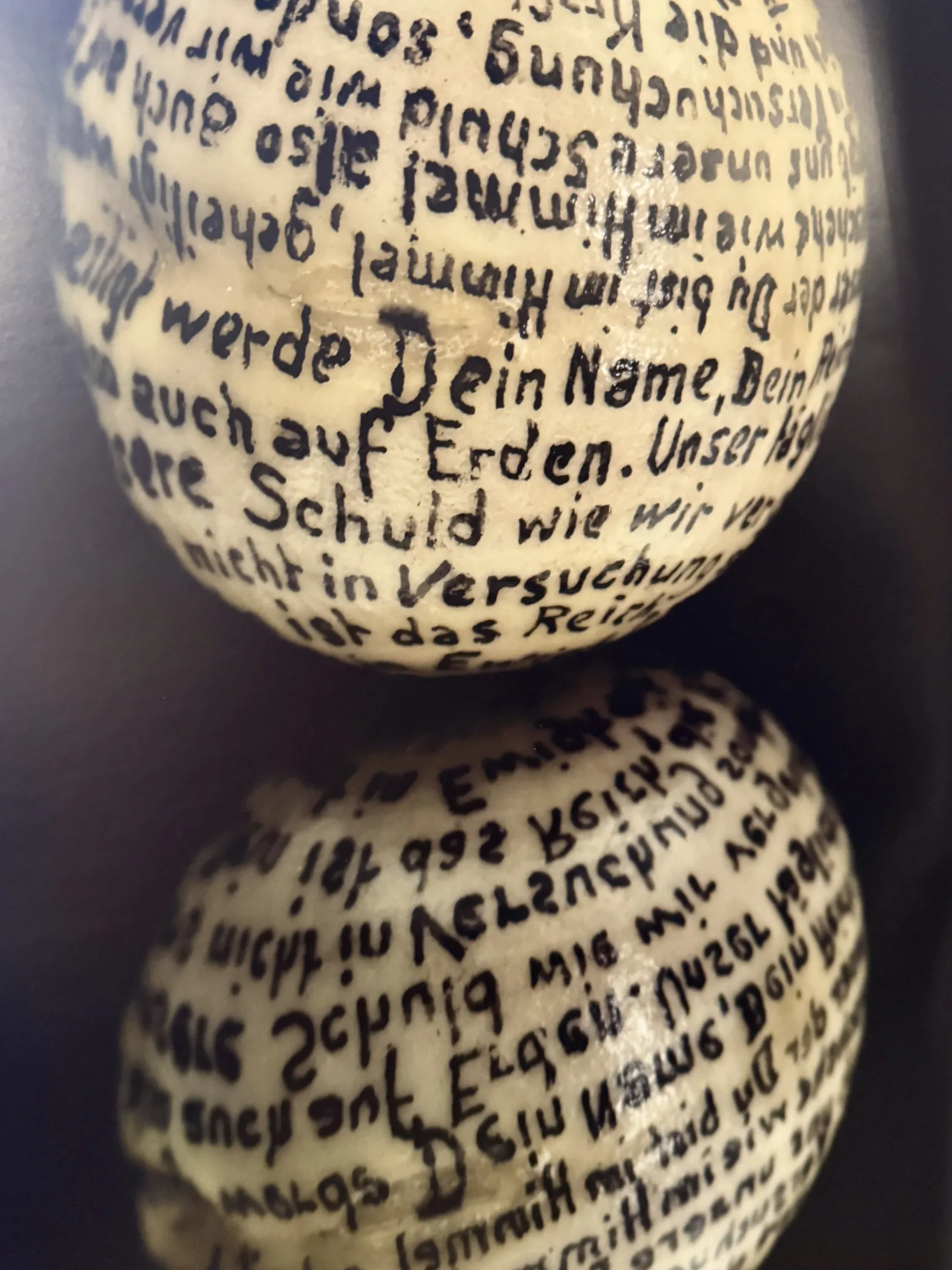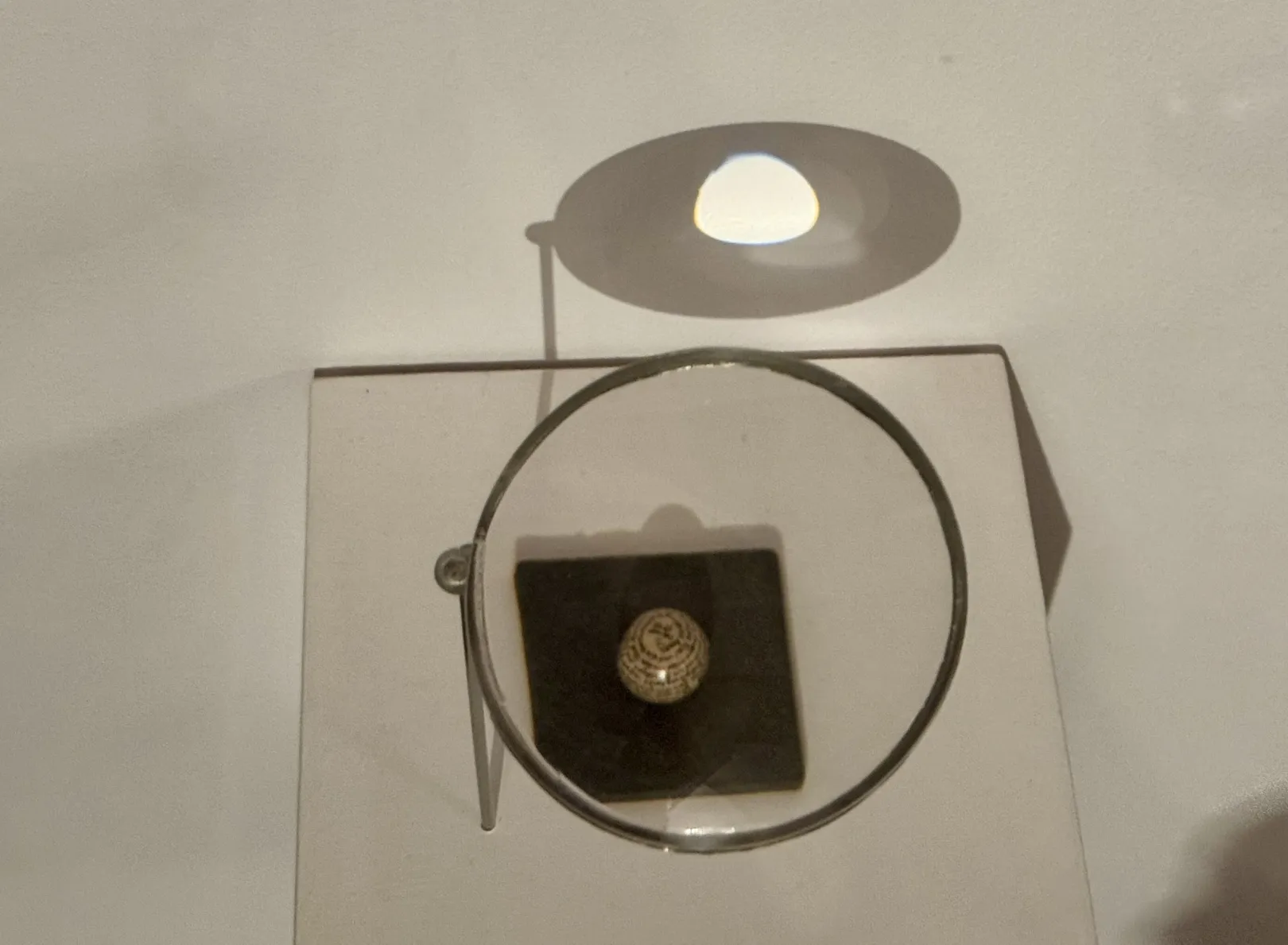Mein Plan war, bis zur Stadtmitte an die Elbe zu gehen, dort meinen Tracker auszuschalten und mich dann in einen Zug nach Königstein zu setzen. Erik, der mich auch schon in Berlin beherbergt hat, hat dort eine Ferienwohnung, die er mir angeboten hat zu benutzen, solange ich in Dresden bin. So muss ich zwar etwas zu meinen Stationen pendeln, aber ich bin an einem herrlichen Ort untergebracht und habe erst einmal Ruhe – darauf habe ich mich sehr gefreut.
Als ich über die Augustusbrücke Richtung Dom lief, wurden alte Erinnerungen wach, die mich mit dieser Stadt verbinden. Vor nunmehr 30 Jahren hat hier eines meiner ersten großen Abenteuer begonnen. Ich war damals in der Nähe von Dresden auf einem großen Pfadfinderlager, und am Ende des Lagers wollten mein damals bester Freund Tobias und ich noch nicht nach Hause. Da wir kein Geld hatten, beschlossen wir, zwei bis drei Tage Straßenmusik in Dresden zu machen und mit den Einnahmen unseren „Urlaub“ zu finanzieren. Weil wir in der Stadt niemanden kannten und die Einnahmen zwar gut waren, aber nicht für Übernachtungen gereicht hätten, schliefen wir unter der Augustusbrücke. Ich glaube, ich habe in dieser Nacht kein Auge zugetan – ständig in der Angst, dass wir dort von Obdachlosen ausgeraubt werden könnten.
Nachdem wir ungefähr 160 Mark verdient hatten, sind wir für eine Woche durch die Sächsische Schweiz gewandert. An eine Nacht erinnere ich mich besonders gut: Aus dem Wald um uns herum waren ständig Geräusche zu hören, und wir waren absolut sicher, dass da jemand ist, der uns beobachtet. Wenn ich heute allein irgendwo im Zelt liege, muss ich oft an diese Nacht zurückdenken und lächle darüber. Der Wald macht immer irgendwelche Geräusche. Er lebt. Und das ist gut so. Heute weiß ich, wie es sich anhört, wenn ein Tier oder ein Mensch durch den Wald geht – und es ist sehr selten, dass ich dadurch aus der Ruhe komme.
Unsere Wanderung führte uns bis nach Tschechien, wo ein Bier damals noch 30 Pfennige kostete. Mit dem Geld, das wir in Dresden verdient hatten, fühlten wir uns wie Könige – was fatale Auswirkungen hatte, als wir uns zum Durstlöschen an einem Kiosk einige kühle Biere gönnten und anschließend den Berg hinauf mussten. Aber es war lehrreich. Das Geld reichte sogar noch, um zwei Tage in Prag zu verbringen und uns dort eine Unterkunft zu leisten. Irgendwann in dieser Zeit habe ich dann auch mal zu Hause angerufen, um zu sagen, dass es uns gut geht und meine Mutter sich keine Sorgen machen muss. Als ich fragte, warum im Hintergrund so viele Stimmen zu hören seien, fragte sie mich, ob ich denn wisse, welcher Tag heute ist. Ich hatte aus purem Zufall an ihrem Geburtstag angerufen – Zeit und Daten spielten bei dieser Reise keine Rolle. Es fühlte sich an wie Freiheit pur.
Vielleicht ist das die Stelle, an der ich auch meiner Mutter danken muss: dass sie mich hat ziehen lassen, als ich ihr unterbreitet habe, dass wir diese Reise machen wollen – ohne viel Geld und Planung. Ich war 16, Tobias vielleicht 15. Und auch meinem Patenonkel muss ich hier danken, den meine Mutter damals konsultiert hat, ob sie mir das erlauben kann. Er stellte sich gegen die Empfehlung seiner Frau und riet meiner Mutter: Lass sie gehen. Wahrscheinlich würde ich heute nicht solche Projekte machen, wenn ich nicht schon in jungen Jahren solche Erfahrungen hätte sammeln dürfen.
So hat das, was ich heute tue, auch etwas mit dem Vertrauen meiner Mutter zu tun, das sie immer in mich hatte. Ich weiß, dass das nicht immer einfach war und manchmal vielleicht auch eine schlaflose Nacht für sie bedeutete. Aber je älter ich wurde, desto mehr wuchs ihr Vertrauen – und auch das Wissen, dass ich in all den Jahren sehr behütet war, wie sie mir vor kurzem mitteilte, als sie den Blogeintrag zu Pablo gelesen hatte, der von weiteren Abenteuern in der Welt handelte.
Als ich nun wieder auf dieser Brücke stand, kamen mir all diese Erinnerungen zurück. Sie zauberten mir ein Lächeln ins Gesicht und gaben mir das Gefühl, dass alles seine Richtigkeit hatte: Damals, ohne Geld unter der Brücke zu schlafen und Straßenmusik zu machen – und heute wieder in diese wunderschöne Stadt zu kommen, im Schweigen, auf einem noch größeren Abenteuer, von dem ich noch keine Ahnung habe, wohin es mich führen wird. Aber das ist nicht das Wichtigste. Viel wichtiger ist es, unterwegs zu sein.
Weil ich durchs Querfeldeinlaufen einige Kilometer eingespart hatte und zwischendrin ordentlich Schnee fiel, sodass ich keine Pause gemacht habe, war ich früher angekommen als gedacht. Es war höchste Zeit, mich irgendwo hinzusetzen und mich auszuruhen. Draußen war es viel zu kalt für eine Pause, und auf Menschen in einem Café hatte ich in diesem Moment keine Lust. Ich wollte Stille, nach innen gehen – und so war der Dom zu meiner Rechten ein mehr als willkommener Ort. Zumal bei diesem Wetter, unter der Woche an einem Montagnachmittag, so gut wie keine Touristen unterwegs waren: Ich hatte die Kirche fast für mich allein.