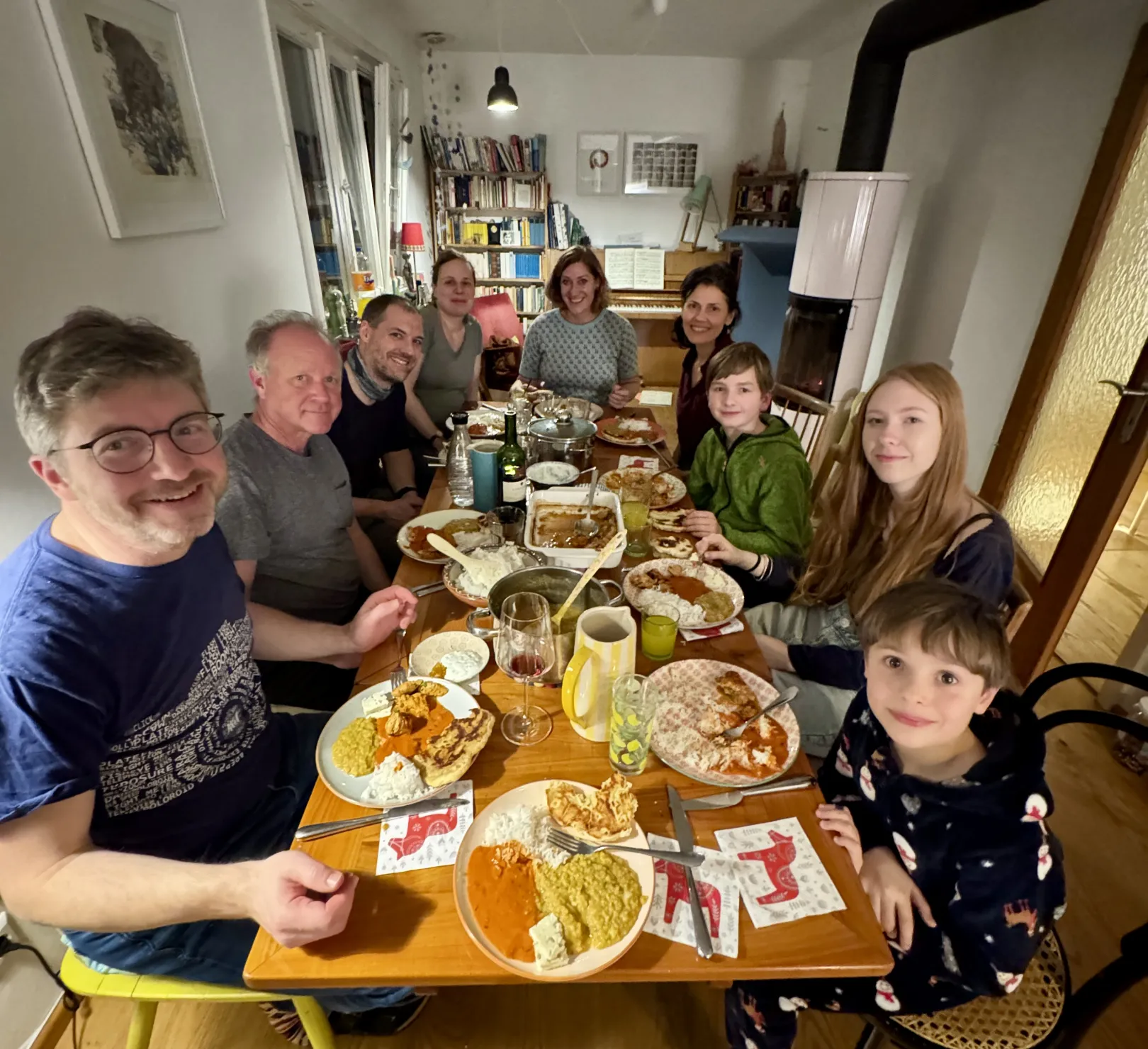Dass mein Weg von Berlin über Luckenwalde führen würde, stand schon lange fest. Einer meiner engsten Freunde und Künstlerkollegen, Pablo Wendel, besitzt dort ein ehemaliges Kohlekraftwerk, das er in ein Kulturzentrum und ein lebendiges Gesamtkunstwerk verwandelt hat: das „E-Werk“ – ein Ort, der nebenbei sogar Kunststrom erzeugt. Aber das ist eine andere Geschichte, der ich bald einen eigenen Beitrag widmen werde.
Für meine Station als Zuhörer suchten wir jedoch nach einem Ort mitten im Stadtzentrum, um die Schwelle möglichst niedrig zu halten – räumlich wie innerlich. Pablo vermittelte mir den Kontakt zum „Open Eck“. Als Begegnungscafé versprach es genau die Offenheit, die ich suchte. Es war meine erste Station in Brandenburg, und ich war gespannt, wie dieses Angebot in einer kleineren Stadt angenommen würde.

Ich kam etwas früher an. Rolf, ein Mitglied des siebenköpfigen Organisationsteams, erzählte mir bei einer Tasse Tee, wo ich hier eigentlich gelandet war.
Das Open Eck ist ein von Ehrenamtlichen getragener Nachbarschafts- und Begegnungsraum, entstanden aus der Initiative lokaler Akteur:innen. Ein Ort für Kunst, Kultur, Austausch und gemeinschaftliches Miteinander. Menschen aller Altersgruppen kommen hier zusammen: zum Kaffeetrinken, für Gespräche, Spiele, Kreativangebote, Musik, Workshops oder einfach, um nicht allein zu sein. Alles bewusst offen und niedrigschwellig gehalten – ein Raum, in dem Menschen aufeinandertreffen, die sich sonst vermutlich nie begegnen würden. Genau der richtige Ort für mein Projekt.
Der Mittwoch, an dem ich dort zuhörte, ist im Open Eck als Familientag etabliert. Offen für alle: Familien, Alleinstehende, Menschen auf der Suche nach Austausch. Der Nachmittag verlief anders, als ich es von anderen Stationen kannte. Es gab einen großen Tisch, an dem ich zunächst mit Rolf saß. Nach und nach setzten sich weitere Menschen dazu. Zwar wurde mir ein separater Tisch für mehr Privatsphäre angeboten, doch die Dynamik am großen Gemeinschaftstisch war so einladend, dass ich einfach dort blieb. Gespräche entstanden in der Gruppe, und ich hörte zu – manchmal Einzelnen, oft dem gemeinsamen Austausch.
Was mich besonders berührte, war die Vielfalt der Menschen an diesem Tisch: vom Arzt im Ruhestand bis zum Analphabeten. Die Themen flossen ineinander – es ging um Abnehmspritzen, um Kunst, um gesundheitliche Fragen, um Alltägliches. Was viele verband, war ein Gefühl von Einsamkeit zu Hause – und das Wissen, hier einen Ort gefunden zu haben, an dem sie Gesellschaft und Verbundenheit erleben, die ihnen zu Hause oft fehlen.
Sie sprechen offen über Dinge wie Einsamkeit, die man sonst lieber verschweigt. Nicht klagend, sondern selbstbewusst. Mit dem Stolz darüber, gemeinsam etwas geschaffen zu haben, das trägt. Besonders berührend war zu sehen, wie aktiv sie andere einladen: Wer neugierig durch das Schaufenster blickt, wird hereingebeten. Was sie selbst erfahren haben, möchten sie unmittelbar weitergeben.
Das Open Eck ist dabei weit mehr als ein Café. Jede und jeder kann sich einbringen. Es gibt Märchenabende mit selbstgeschriebenen Geschichten für Kinder, ein Reparaturcafé, einen Chor, Spieleabende, ein Sprachcafé für Menschen mit Fluchterfahrung, spirituellen Austausch, Energiearbeit, Yoga und vieles mehr. Wenn jemand eine Idee hat und andere daran teilnehmen möchten, wird daraus ein fester Bestandteil des Programms.

Später kam auch Vero vorbei, eine der Gründerinnen. Während Corona kehrte sie in ihre Heimatstadt zurück und bekam ein Kind. Für sie als junge Mutter war es schwierig, nicht zu vereinsamen und wieder gesellschaftlich Fuß zu fassen. Eine Trennung verstärkte den Wunsch nach neuen Verbindungen. Ein Teil ihrer Elternzeit floss schließlich in die Gründung des Open Ecks. Für sie wurde dieser Raum zur Grundlage, um in der alten Heimat wieder anzukommen, eine schwere Phase der Isolation zu überwinden – und zugleich einen Ort zu schaffen, der auch anderen Halt gibt.
Das ist es, was ich an den Menschen hier am meisten bewundere: Anstatt sich ihrem Schicksal zu ergeben oder frustriert vor dem Fernseher zu resignieren, haben sie ihr Leben selbst in die Hand genommen. Sie haben erkannt, dass ihr Engagement nicht nur ihnen selbst hilft, sondern eine sinnstiftende Wirkung für die ganze Stadt entfaltet. Das gibt Sinn, Verbundenheit und Lebensfreude zurück.
Gerade in Zeiten, in denen politische Kräfte zunehmend vom Frust und der Einsamkeit vieler Menschen profitieren, erscheinen mir Orte wie dieser umso wichtiger. Nicht als Gegenrede, sondern als gelebte Alternative. Als Raum, in dem Menschen erfahren: Ich kann etwas tun. Ich bin nicht allein.
Das Open Eck gibt es erst seit einem Jahr. Es ist beeindruckend, was in dieser Zeit entstanden ist. Ich wünsche mir, dass dieser Ort weiter wächst, noch mehr Menschen erreicht – und dass ähnliche Räume auch an anderen Orten entstehen. Denn solche Initiativen machen mir Mut. Mehr denn je.